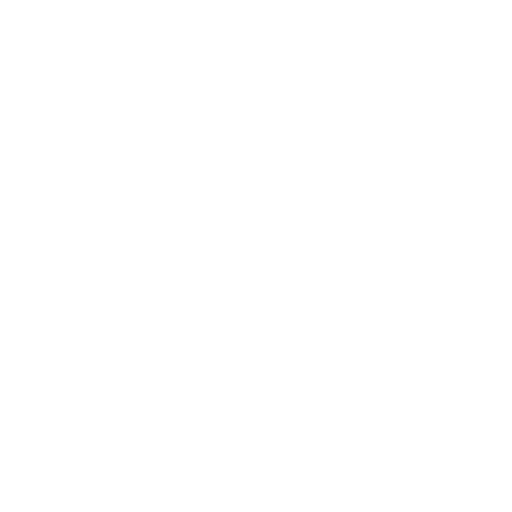Beim msg-Stadtspaziergang erläutern Expertinnen und Experten,
wie Digitalisierung den Menschen das Leben erleichtern kann.
Dieses Mal geht es um die Frage, wie Berlins
Infrastruktur mittels Daten besser werden könnte.
Ziemlich genau vor dem Roten Rathaus wird klar, dass etwas schiefgelaufen ist. Es sollte doch nur noch mal schnell zum Alexanderplatz gehen. Doch stattdessen herrscht Stadt-Stau. Auf der Busspur steht ein Lieferwagen. Ein gelber Linienbus drängelt sich an dem Lieferwagen vorbei an die Haltestelle. Hupen. Menschen auf Fahrrädern zischen an Bus, Lieferwagen und stockendem Verkehr vorbei. Von der Parkplatzfrage ganz zu schweigen. Berlin ist für Autos gemacht. Aber auch für Autos kann es in der Stadt stressig sein, genauso wie für Busse, Fahrräder oder zu Fuß. „Das ist gerade aber nicht sehr smart gelöst,“ sagt Joachim Schonowski, der Smart-City-Experte von msg, bei einem Blick aus dem Autofenster.
Für den ersten Teil des Stadtspaziergangs ging es zum Ernst-Reuter-Platz, dem „Platz der roten Ampeln.“ Jetzt geht es weiter zum Alexanderplatz. Eigentlich wäre der Weg sehr einfach. Vom Ernst-Reuter-Platz in Berlins Westen zum Alexanderplatz im Osten: Sechs Kilometer die B2 entlang, immer geradeaus. Aber so einfach sind Städte natürlich nicht. Und das stresst: Laut einer msg-Umfrage sind Infrastruktur und Mobilität die Punkte, die die meisten Großstädter als Stressfaktoren nennen. Was bei dieser Stadtrundfahrt interessiert: Wie Städte und ihr Verkehr funktionieren, wie es besser laufen könnte – und was es dafür bräuchte.
Aber erstmal zurück zum Reuter-Platz. Ab der Pestalozzistraße geht es in einem Carsharing-E-Auto weiter. „Bedarfsorientierte Mobilität,“ sagt Smart-City-Experte Schonowski, als er in das Auto einsteigt. Weil der Bildschirm des Navis schwarz bleibt, muss aber erstmal klassisch navigiert werden. Klassisch für Berlin bedeutet: Ein Beifahrer der Google Maps vorliest und auf Fahrradfahrerinnen und -fahrer achtet. Denn: Berlin gilt als extrem gefährlich für Radelnde. Laut einer Statistik der Polizei, sind 2022 allein 7450 Fahrradfahrerinnen und -fahrer im Straßenverkehr verunglückt – 10 davon tödlich. „Achtung, da kommt noch einer,“ sagt Schonowski. „Jetzt kann es weitergehen.“
Ziemlich genau vor dem Roten Rathaus wird klar, dass etwas schiefgelaufen ist. Es sollte doch nur noch mal schnell zum Alexanderplatz gehen. Doch stattdessen herrscht Stadt-Stau. Auf der Busspur steht ein Lieferwagen. Ein gelber Linienbus drängelt sich an dem Lieferwagen vorbei an die Haltestelle. Hupen. Menschen auf Fahrrädern zischen an Bus, Lieferwagen und stockendem Verkehr vorbei. Von der Parkplatzfrage ganz zu schweigen. Berlin ist für Autos gemacht. Aber auch für Autos kann es in der Stadt stressig sein, genauso wie für Busse, Fahrräder oder zu Fuß. „Das ist gerade aber nicht sehr smart gelöst,“ sagt Joachim Schonowski, der Smart-City-Experte von msg, bei einem Blick aus dem Autofenster.
Für den ersten Teil des Stadtspaziergangs ging es zum Ernst-Reuter-Platz, dem „Platz der roten Ampeln.“ Jetzt geht es weiter zum Alexanderplatz. Eigentlich wäre der Weg sehr einfach. Vom Ernst-Reuter-Platz in Berlins Westen zum Alexanderplatz im Osten: Sechs Kilometer die B2 entlang, immer geradeaus. Aber so einfach sind Städte natürlich nicht. Und das stresst: Laut einer msg-Umfrage sind Infrastruktur und Mobilität die Punkte, die die meisten Großstädter als Stressfaktoren nennen. Was bei dieser Stadtrundfahrt interessiert: Wie Städte und ihr Verkehr funktionieren, wie es besser laufen könnte – und was es dafür bräuchte.
Aber erstmal zurück zum Reuter-Platz. Ab der Pestalozzistraße geht es in einem Carsharing-E-Auto weiter. „Bedarfsorientierte Mobilität,“ sagt Smart-City-Experte Schonowski, als er in das Auto einsteigt. Weil der Bildschirm des Navis schwarz bleibt, muss aber erstmal klassisch navigiert werden. Klassisch für Berlin bedeutet: Ein Beifahrer der Google Maps vorliest und auf Fahrradfahrerinnen und -fahrer achtet. Denn: Berlin gilt als extrem gefährlich für Radelnde. Laut einer Statistik der Polizei, sind 2022 allein 7450 Fahrradfahrerinnen und -fahrer im Straßenverkehr verunglückt – 10 davon tödlich. „Achtung, da kommt noch einer,“ sagt Schonowski. „Jetzt kann es weitergehen.“

Sensoren in Autos
Aber Verkehr in Berlin ist nicht nur eine Frage der Schilder, weißen Linien und Ampeln: An der Kantstraße geht die Fahrt im Elektroauto an einer alten Matratze und Sperrmüll vorbei, die am Straßenrand liegen. „Für die Stadt Köln erfassen wir Straßenschäden, Straßenverunreinigungen, verstopfte Gullydeckel und so etwas schon mit KI,“ erzählt Schonowski. „Als Fahrzeuge werden dafür die Müllfahrzeuge der AWB Köln genutzt, die mit Kameras ausgestattet sind.“ In einem nächsten Schritt, so Schonowski, soll auch Sperrmüll am Straßenrand erfasst und registriert werden, und sogar verschmutzte Verkehrsschilder.
Mit Daten die Infrastruktur einer Stadt besser zu machen, ist ein großes Thema. Mit mehr Daten aus dem Verkehr ließe sich allerhand anstellen: Man könnte die Ampelphasen von einem Platz wie dem Ernst-Reuter-Platz optimieren oder auf besonders beliebten Routen mehr öffentlichen Nahverkehr anbieten. Autos, die in der ganzen Stadt herumkommen, so Schonowski, sind „natürlich prädestiniert dafür. Deshalb nimmt man ja auch so was wie ein Müllauto. Etwas, das zwar seine Routen hat, aber eben nichtsdestotrotz im ganzen Stadtgebiet rumfährt."
Kurz vor dem Bahnhof Zoo kommt die Navigation aber durcheinander, eine Baustelle war scheinbar nicht eingeplant. Es ist einer dieser Momente im Straßenverkehr, bei dem man sich denkt: „Ähm… ok… hier sollte ich nicht stehen. Ich fahre jetzt ganz langsam da rüber und hoffe, dass es niemand gesehen hat.“
Sensoren in Autos
Aber Verkehr in Berlin ist nicht nur eine Frage der Schilder, weißen Linien und Ampeln: An der Kantstraße geht die Fahrt im Elektroauto an einer alten Matratze und Sperrmüll vorbei, die am Straßenrand liegen. „Für die Stadt Köln erfassen wir Straßenschäden, Straßenverunreinigungen, verstopfte Gullydeckel und so etwas schon mit KI,“ erzählt Schonowski. „Als Fahrzeuge werden dafür die Müllfahrzeuge der AWB Köln genutzt, die mit Kameras ausgestattet sind.“ In einem nächsten Schritt, so Schonowski, soll auch Sperrmüll am Straßenrand erfasst und registriert werden, und sogar verschmutzte Verkehrsschilder.
Mit Daten die Infrastruktur einer Stadt besser zu machen, ist ein großes Thema. Mit mehr Daten aus dem Verkehr ließe sich allerhand anstellen: Man könnte die Ampelphasen von einem Platz wie dem Ernst-Reuter-Platz optimieren oder auf besonders beliebten Routen mehr öffentlichen Nahverkehr anbieten. Autos, die in der ganzen Stadt herumkommen, so Schonowski, sind „natürlich prädestiniert dafür. Deshalb nimmt man ja auch so was wie ein Müllauto. Etwas, das zwar seine Routen hat, aber eben nichtsdestotrotz im ganzen Stadtgebiet rumfährt."
Kurz vor dem Bahnhof Zoo kommt die Navigation aber durcheinander, eine Baustelle war scheinbar nicht eingeplant. Es ist einer dieser Momente im Straßenverkehr, bei dem man sich denkt: „Ähm… ok… hier sollte ich nicht stehen. Ich fahre jetzt ganz langsam da rüber und hoffe, dass es niemand gesehen hat.“

Was Datensouveränität bedeutet
In der Fasanenstraße geht es vorbei an einer von über 1000 E-Auto-Ladestationen der Berliner Stadtwerke. Wenn die richtigen Daten von Berliner Miet-Elektroautos zusammenlaufen würden, so Schonowski, ließen sich damit auch andere Fragen beantworten. Fragen wie: „Wo sollte ich denn eine Elektro-Säule aufstellen? Wo macht es denn am meisten Sinn? Dabei, so Schonowski, kommt es nicht nur darauf an, die Daten zu haben, sondern auch darauf, sie zu organisieren. „Für das alles musst du unterschiedliche Daten zusammenführen, an einem Punkt. Früher sind die Leute von Büro A zu Büro B gegangen und haben sich dann den Aktenordner geholt und genau das gleiche gemacht.“
Im umgebenden Verkehr fallen die Autos verschiedener Carsharing-Anbieter auf: Gemietete E-Roller, E-Fahrräder, Lieferanten in Autos und Lieferanten auf Fahrrädern. Viele von ihnen sind mit GPS-Sendern unterwegs. Damit Kunden den Weg ihres Mittagessens oder ihrer Pakete verfolgen können, oder damit sie die Fahrzeuge der „Bedarfsorientierten Mobilität“ überhaupt erst finden können. Die Firmen, die dahinterstehen, werten diese Daten über die gefahrenen Strecken zweifellos schon aus. Die Frage ist nur, wie käme eine Stadt an solche Daten? Denn: Für Städte wäre es wichtig, dass diese Daten auch ihnen zur Verfügung stehen, und sie auch davon profitieren können.
Das Verhältnis von Städten zu Sharing-Anbietern aber ist komplex: Sharing-Anbieter nutzen die Infrastrukturen von Städten, um Geld zu verdienen. Sie stellen Städten aber im Gegenzug oft nicht die Daten zur Verfügung. Kleinere Kommunen, so Schonowski, sind froh, wenn sich dort überhaupt ein Anbieter ansiedelt, und trauen sich auch nicht, Daten zu fordern. Für Berlin, so Schonowski, sollte es aber möglich sein, die Vergabe von Carsharing-Lizenzen mit einer Übermittlungspflicht bestimmter Daten zu verknüpfen. Hier ist neben dem politischen Willen natürlich auch ein Nachnutzungskonzept gefragt, damit die Daten auch sinnvoll zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger verarbeitet werden. Berlin, fährt Schonowski fort, ist mittlerweile schon geknebelt von den ganzen herumliegenden E-Rollern. Die Menschen in Paris hingegen, waren so genervt von den Rollern, dass sie sich dafür entschieden haben, sie wieder abzuschaffen.
Nun geht es rechts ab auf die Straße des 17. Juni, zurück auf Berlins zentrale Achse. Die Straße ist teilweise bis zu acht Spuren breit, es gibt einen Mittelstreifen, Parkplätze, Fahrradwege und Bürgersteige. Die Straße ist tatsächlich so breit, dass gelegentlich Großveranstaltungen darauf stattfinden: Sie ist auch Berlins zentrale Fußball-WM-Fanmeile. Heute sind es sechs Reihen Autos, mitten im Tiergarten, mit Sicht auf die Siegessäule, das Brandenburger Tor und den Fernsehturm in der Ferne.
Was Datensouveränität bedeutet
In der Fasanenstraße geht es vorbei an einer von über 1000 E-Auto-Ladestationen der Berliner Stadtwerke. Wenn die richtigen Daten von Berliner Miet-Elektroautos zusammenlaufen würden, so Schonowski, ließen sich damit auch andere Fragen beantworten. Fragen wie: „Wo sollte ich denn eine Elektro-Säule aufstellen? Wo macht es denn am meisten Sinn? Dabei, so Schonowski, kommt es nicht nur darauf an, die Daten zu haben, sondern auch darauf, sie zu organisieren. „Für das alles musst du unterschiedliche Daten zusammenführen, an einem Punkt. Früher sind die Leute von Büro A zu Büro B gegangen und haben sich dann den Aktenordner geholt und genau das gleiche gemacht.“
Im umgebenden Verkehr fallen die Autos verschiedener Carsharing-Anbieter auf: Gemietete E-Roller, E-Fahrräder, Lieferanten in Autos und Lieferanten auf Fahrrädern. Viele von ihnen sind mit GPS-Sendern unterwegs. Damit Kunden den Weg ihres Mittagessens oder ihrer Pakete verfolgen können, oder damit sie die Fahrzeuge der „Bedarfsorientierten Mobilität“ überhaupt erst finden können. Die Firmen, die dahinterstehen, werten diese Daten über die gefahrenen Strecken zweifellos schon aus. Die Frage ist nur, wie käme eine Stadt an solche Daten? Denn: Für Städte wäre es wichtig, dass diese Daten auch ihnen zur Verfügung stehen, und sie auch davon profitieren können.

Das Verhältnis von Städten zu Sharing-Anbietern aber ist komplex: Sharing-Anbieter nutzen die Infrastrukturen von Städten, um Geld zu verdienen. Sie stellen Städten aber im Gegenzug oft nicht die Daten zur Verfügung. Kleinere Kommunen, so Schonowski, sind froh, wenn sich dort überhaupt ein Anbieter ansiedelt, und trauen sich auch nicht, Daten zu fordern. Für Berlin, so Schonowski, sollte es aber möglich sein, die Vergabe von Carsharing-Lizenzen mit einer Übermittlungspflicht bestimmter Daten zu verknüpfen. Hier ist neben dem politischen Willen natürlich auch ein Nachnutzungskonzept gefragt, damit die Daten auch sinnvoll zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger verarbeitet werden. Berlin, fährt Schonowski fort, ist mittlerweile schon geknebelt von den ganzen herumliegenden E-Rollern. Die Menschen in Paris hingegen, waren so genervt von den Rollern, dass sie sich dafür entschieden haben, sie wieder abzuschaffen.
Nun geht es rechts ab auf die Straße des 17. Juni, zurück auf Berlins zentrale Achse. Die Straße ist teilweise bis zu acht Spuren breit, es gibt einen Mittelstreifen, Parkplätze, Fahrradwege und Bürgersteige. Die Straße ist tatsächlich so breit, dass gelegentlich Großveranstaltungen darauf stattfinden: Sie ist auch Berlins zentrale Fußball-WM-Fanmeile. Heute sind es sechs Reihen Autos, mitten im Tiergarten, mit Sicht auf die Siegessäule, das Brandenburger Tor und den Fernsehturm in der Ferne.

"Wie schaffe ich das,
dass alles interoperabel ist?"
dass alles interoperabel ist?"
„Fläche ist eins der wichtigsten Themen der Stadtplanung,“ gibt Schonowski zu bedenken. Dabei geht es nicht nur um Straßen und Plätze, sondern alle Flächen, auch Dächer und Wände. Und damit taucht auch die Frage auf: Welche Flächen hat eine Stadt eigentlich, für Solaranlagen zum Beispiel? „Es gibt den Begriff des Solarkatasters,“ erklärt Schonowski. „Dass man darüber nachdenkt, welche Dächer sich optimal anbieten. Und damit stellt sich auch die Frage: Wie könnte man das einspeisen, wie würde das mit dem Netz funktionieren?“
Natürlich wäre es auch praktisch, Ladestationen in der Nähe von großen Solarflächen zu haben. „Es gibt mindestens zwei zentrale Ebenen in diesem Kontext,“ erklärt Schonowski. „Das eine ist die technische Ebene: Wie schaffe ich das, dass alles interoperabel ist, miteinander reden kann, dass die Daten untereinander austauschbar sind. Es geht also um das Datenmodell.“ Die andere Ebene, so Schonowski „ist die organisatorische: Wer kümmert sich denn zum Beispiel um die Datensouveränität und den Datenschutz? Wer kümmert sich um Privatsphäre und ermöglicht Wettbewerb?“
Ein digitaler Zwilling, ein digitales Modell der Stadt also, in der solche Daten in Echtzeit einfließen, könnte so einen Prozess wesentlich einfacher machen. Gerade für den Wettbewerb wären auch standardisierte Schnittstellen besonders wichtig.
„Wie schaffe ich das, dass alles interoperabel ist?“
„Fläche ist eins der wichtigsten Themen der Stadtplanung,“ gibt Schonowski zu bedenken. Dabei geht es nicht nur um Straßen und Plätze, sondern alle Flächen, auch Dächer und Wände. Und damit taucht auch die Frage auf: Welche Flächen hat eine Stadt eigentlich, für Solaranlagen zum Beispiel? „Es gibt den Begriff des Solarkatasters,“ erklärt Schonowski. „Dass man darüber nachdenkt, welche Dächer sich optimal anbieten. Und damit stellt sich auch die Frage: Wie könnte man das einspeisen, wie würde das mit dem Netz funktionieren?“
Natürlich wäre es auch praktisch, Ladestationen in der Nähe von großen Solarflächen zu haben. „Es gibt mindestens zwei zentrale Ebenen in diesem Kontext,“ erklärt Schonowski. „Das eine ist die technische Ebene: Wie schaffe ich das, dass alles interoperabel ist, miteinander reden kann, dass die Daten untereinander austauschbar sind. Es geht also um das Datenmodell.“ Die andere Ebene, so Schonowski „ist die organisatorische: Wer kümmert sich denn zum Beispiel um die Datensouveränität und den Datenschutz? Wer kümmert sich um Privatsphäre und ermöglicht Wettbewerb?“
Ein digitaler Zwilling, ein digitales Modell der Stadt also, in der solche Daten in Echtzeit einfließen, könnte so einen Prozess wesentlich einfacher machen. Gerade für den Wettbewerb wären auch standardisierte Schnittstellen besonders wichtig.
Ein Problem für einen technischen Dienstleister
Zu einem nicht unerheblichen Teil managt Google gerade den Berliner Verkehrsfluss. Google Maps schickt unser Fahrzeug, weil es scheinbar der schnellste Weg ist, durch die Auguststraße. „Das macht stadtplanerisch gerade tatsächlich wenig Sinn, dass wir jetzt hier lang fahren. Es ist eine absolute Wohn- und Flanier-Gegend,“ stellt Schonowski fest. Aber es ist nicht nur Google Maps: In der Friedrichstraße, Berlins historischer Mitte, wurde die Fußgängerzone gerade wieder von Berlins Verkehrssenatorin aufgelöst. Die Straßencafés dort mussten pünktlich zu Beginn des Sommers wieder abgebaut werden.
Über ein paar kleinere Straßen geht es wieder auf die B2, die direkte Straße zum Alexanderplatz. Im stockenden Verkehr, zwischen Bussen, Lieferwagen und Fahrrädern, bleibt genug Zeit, sich das Rote Rathaus anzuschauen – der Ort, an dem für Berlin Entscheidungen gefällt werden.
Es stellt sich die Frage: Wie könnte eine Stadt oder ein technischer Dienstleister ein System aufbauen, das so unterschiedliche Dinge wie Verkehrsaufkommen, Ampelphasen, Straßenschäden, E-Auto-Ladesäulen und Solar-Flächen berücksichtigt?
„Damit dies nachhaltig funktioniert, müssen hierfür mehrere Rahmenbedingungen geschaffen werden,“ erklärt Smart-City-Experte Joachim Schonowski. Zum einen brauche es eine skalierbare Infrastruktur in Form einer IoT- und Datenplattform, welche alle relevanten Informationen einsammeln, in geordnete und nachnutzbare Strukturen bringen und über die Zeit aufwachsen kann.
Daneben wäre ein Technischer Dienstleister, wie z. B. msg gefordert, der Anwendungsszenarien konkret umsetzen und hierfür die richtigen Services programmieren könnte. Und drittens, und dieser Punkt ist Schonowski besonders wichtig, sollten die Anwendungsszenarien mit einer konkreten Nutzenbetrachtung erarbeitet und beschlossen werden. Hier sei neben einer fachlichen und methodischen Beratung die Stadtverwaltung und die Stadtpolitik, idealerweise unter Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger, im Besonderen gefordert.
„Als Stadt definierst du, welche Ziele du verfolgen und welche Daten du einbeziehen möchtest und wir als Dienstleister entwerfen eine konkrete Lösung und setzen diese um,“ so Schonowski.

Ein Problem für einen technischen Dienstleister
Zu einem nicht unerheblichen Teil managt Google gerade den Berliner Verkehrsfluss. Google Maps schickt unser Fahrzeug, weil es scheinbar der schnellste Weg ist, durch die Auguststraße. „Das macht stadtplanerisch gerade tatsächlich wenig Sinn, dass wir jetzt hier lang fahren. Es ist eine absolute Wohn- und Flanier-Gegend,“ stellt Schonowski fest. Aber es ist nicht nur Google Maps: In der Friedrichstraße, Berlins historischer Mitte, wurde die Fußgängerzone gerade wieder von Berlins Verkehrssenatorin aufgelöst. Die Straßencafés dort mussten pünktlich zu Beginn des Sommers wieder abgebaut werden.
Über ein paar kleinere Straßen geht es wieder auf die B2, die direkte Straße zum Alexanderplatz. Im stockenden Verkehr, zwischen Bussen, Lieferwagen und Fahrrädern, bleibt genug Zeit, sich das Rote Rathaus anzuschauen – der Ort, an dem für Berlin Entscheidungen gefällt werden.
Es stellt sich die Frage: Wie könnte eine Stadt oder ein technischer Dienstleister ein System aufbauen, das so unterschiedliche Dinge wie Verkehrsaufkommen, Ampelphasen, Straßenschäden, E-Auto-Ladesäulen und Solar-Flächen berücksichtigt?
„Damit dies nachhaltig funktioniert, müssen hierfür mehrere Rahmenbedingungen geschaffen werden,“ erklärt Smart-City-Experte Joachim Schonowski. Zum einen brauche es eine skalierbare Infrastruktur in Form einer IoT- und Datenplattform, welche alle relevanten Informationen einsammeln, in geordnete und nachnutzbare Strukturen bringen und über die Zeit aufwachsen kann.
Daneben wäre ein Technischer Dienstleister, wie z. B. msg gefordert, der Anwendungsszenarien konkret umsetzen und hierfür die richtigen Services programmieren könnte. Und drittens, und dieser Punkt ist Schonowski besonders wichtig, sollten die Anwendungsszenarien mit einer konkreten Nutzenbetrachtung erarbeitet und beschlossen werden. Hier sei neben einer fachlichen und methodischen Beratung die Stadtverwaltung und die Stadtpolitik, idealerweise unter Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger, im Besonderen gefordert.
„Als Stadt definierst du, welche Ziele du verfolgen und welche Daten du einbeziehen möchtest und wir als Dienstleister entwerfen eine konkrete Lösung und setzen diese um,“ so Schonowski.

Als die Fahrt schlussendlich am Alexanderplatz endet, folgt die Feststellung, dass es dort natürlich unmöglich ist, zu parken. Vielleicht in den Nebenstraßen? Aber auch dort – keine Chance. „Idealerweise baut man natürlich ein System, das auch wachsen kann. Bei dem immer mehr Teilsysteme hinzukommen können,“ sagt Schonowski. „Zum Beispiel auch Infrastrukturen, wie intelligente Straßenlaternen, die mit der stadteigenen IoT- und Datenplattform vernetzt sind. Diese können aber auch noch mehr: So lassen sich diese mit Feinstaubsensoren ausstatten, um auch hier einen Überblick zu bekommen und ggf. stark belastete Zonen aktiv zu meiden.“ Solche Systeme hätten natürlich auch bei unserer Parkplatzsuche helfen können…
Als die Fahrt schlussendlich am Alexanderplatz endet, folgt die Feststellung, dass es dort natürlich unmöglich ist, zu parken. Vielleicht in den Nebenstraßen? Aber auch dort – keine Chance. „Idealerweise baut man natürlich ein System, das auch wachsen kann. Bei dem immer mehr Teilsysteme hinzukommen können,“ sagt Schonowski. „Zum Beispiel auch Infrastrukturen, wie intelligente Straßenlaternen, die mit der stadteigenen IoT- und Datenplattform vernetzt sind. Diese können aber auch noch mehr: So lassen sich diese mit Feinstaubsensoren ausstatten, um auch hier einen Überblick zu bekommen und ggf. stark belastete Zonen aktiv zu meiden.“ Solche Systeme hätten natürlich auch bei unserer Parkplatzsuche helfen können…