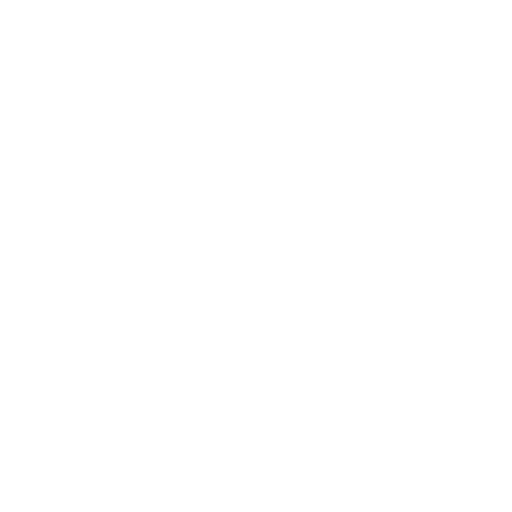Zuerst erschienen in der Ausgabe .public 03-2019
von Thomas Hermann
Entscheiden in Situationen der Ungewissheit mit Effectuation
Eigentlich ist alles ganz einfach: Viele Begebenheiten im (Berufs-) Leben folgen einer simplen kausalen Regel. Wenn eine bestimmte Ausgangssituation gegeben ist, dann erfolgt aus dem vorliegenden Geschäftsumfeld eine mehr oder weniger vorhersagbare Reaktion. Das Wissen über „Wenn das eintritt, passiert Folgendes“ ist die Grundlage von planerischem Vorgehen, das uns so vertraut und alltäglich vorkommt, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken, warum wir uns so gut darauf verlassen können.
Doch woher haben wir dieses Wissen? Wir können beobachten und Rückschlüsse ziehen, von anderen lernen oder selbst die Initiative ergreifen und ausprobieren. Erst dann liegt die Erfahrung vor, und wir können diese Erkenntnis auf andere Situationen übertragen und anwenden. Ohne den Test einer Hypothese bleibt die Annahme eine Theorie. Vor dem Plan steht somit immer eine Phase „Versuch und Irrtum“, also handeln, beobachten und schlussfolgern. Mit anderen Worten: Jemand hat etwas gemacht, um herauszufinden, was dabei herauskommt. Handeln ist eine Schlüsselfunktion, planen können wir erst später.
Dieser Artikel zeigt, wie man in bestimmten Situationen vorgehen kann, wenn ein solches Vorgehen nicht möglich ist: weil Informationen fehlen, es keine Zeit zur Aufbereitung gibt oder einfach alles viel zu komplex und undurchschaubar ist. Und er zeigt, welche Parallelen es zwischen dem im Folgenden vorgestellten Denkansatz Effectuation und agilen Methoden in Projekten gibt.
Die Studien
Effectuation, abgeleitet von „to effectuate = bewirken“, wurde von Saras D. Sarasvathy im Rahmen ihrer Promotion begründet und im Journal „The Academy of Management Review“ im Jahr 2001 veröffentlicht.1 Effectuation gehört thematisch zur Entrepreneurship- Forschung2, also der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Unternehmertum.
Für Unternehmer geht es immer um existenzielle Fragen. Saras D. Sarasvathy hat in einer Studie Ende der 1990er-Jahre das Vorgehen von erfolgreichen Unternehmensgründern und auch Mehrfachgründern systematisch untersucht und daraus den Effectuation-Ansatz entwickelt.
Die Prinzipien
Effectuation verfolgt – im Gegensatz zu „Causation“ (Kausalzusammenhang), also dem Denken in Wenn-/Dann-Kategorien – einen Denkansatz, der in Situationen der Ungewissheit3 angewendet werden kann. Im Unterschied zu Unsicherheit können bei Ungewissheit keinerlei Berechnungen oder Schätzungen in Form von Wahrscheinlichkeiten gemacht werden, da die Alternativen nicht bekannt sind, konkret weil beispielsweise der Markt für ein Produkt (noch) gar nicht existiert.
Effectuation geht davon aus, dass man die Zukunft beeinflussen kann, ohne sie vorhersagen zu müssen. Der Denkansatz beruht auf vier Prinzipien:
1. Mittelorientierung statt Zielorientierung
Was kann ich mit den verfügbaren Mitteln machen und was nicht? Welche Mittel brauche ich, um ein Ziel zu erreichen?
2. Leistbarer Verlust statt erwarteter Ertrag
Bevor ich an Gewinn denken kann, lege ich fest, welchen Verlust ich verkraften kann, wenn es schiefgehen sollte.
3. Chancen nutzen statt Risiken zu vermeiden
Zufälle nicht als Störung wahrnehmen, sondern als Impulsgeber einbeziehen
4. Kooperation statt Konkurrenz
Welche Partner wären bereit, ein Commitment einzugehen und eigene Mittel und Ideen (Co-Creation) einzubringen?
Unternehmer möchten die Zukunft gestalten. Ihr Credo ist das Handeln und daher verlassen sie sich weniger auf Prognosen als vielmehr auf das, was sie haben und was sie können. Das eigentliche Geschäftsziel ist nicht das Ergebnis einer strategischen Planung, sondern das Ergebnis eines Lernprozesses aus der Interaktion mit Kunden und Geschäftspartnern.
Stellt man Causation- und Effectuation-Ansatz direkt gegenüber, erkennt man die zum Teil diametrale Herangehensweise.

Abbildung 1: Causation- und Effectuation-Ansatz im Vergleich
Wie äußern sich die Prinzipien in der Anwendung? Gibt es eine Abfolge, gibt es eine Art von Handlungsanweisung?
Bei den Studien von Saras D. Sarasvathy hat sich ein Handlungsschema herauskristallisiert, das als Prozess dargestellt werden kann. Tatsächlich ist jedoch zu beachten, dass es sich dabei um eine Beschreibung der üblichen Vorgehensweise von Unternehmern handelt, wenn sie allgemein mit dem Thema „Mach etwas Neues“ konfrontiert werden.
Der Prozess ist in diesem Sinn eher als eine Dokumentation der üblichen Handlungsstränge des Unternehmers zu sehen als eine zwingende Wenn-/Dann-Handlungsvorgabe.
Der Effectuation-Prozess

Abbildung 2: Der Effectuation-Prozess5
1. Effectuation beginnt mit einem Auslöser, vielleicht einer ungefähren Vorstellung von etwas oder der Unzufriedenheit über irgendetwas. Daraus entspringt der Wille, etwas zu tun, etwas zu verbessern, etwas Neues, etwas von Wert zu schaffen. Am Anfang steht das, was man hat, seine Fähigkeiten, seine Kontakte und seine (finanziellen) Mittel, und man wartet nicht, sondern fängt einfach an. Die Ziele sind zu diesem Zeitpunkt vage, es gibt einen Blumenstrauß an Möglichkeiten.
2. Der Unternehmer spricht mit seinem Netzwerk (Freunde, Partner) und lädt es ein, einen Beitrag zu leisten. Interesse wird geweckt, es gibt erste Absprachen, man tut sich zusammen, neue Ressourcen werden eingebracht. Die Ziele konkretisieren sich oder werden in eine neue Richtung gelenkt, da durch die Absprachen neue Rahmenbedingungen entstehen. Beides ist in Ordnung, und der Zyklus kann erneut durchlaufen werden.
3. Es ist kein Problem, wenn sich im Umfeld die Parameter ändern sollten, die ihrerseits die verfügbaren Mittel oder die Rahmenbedingungen beeinflussen. Gegebenenfalls kann wieder bei null begonnen werden. Der Prozess mit seinen Aktivitäten ist robust, sofern die Akteure hinreichend resilient, also beispielsweise Optimisten oder Macher sind. Wenn sich keine Mitstreiter finden oder keine Vereinbarungen erzielen lassen, wird das Vorhaben zunächst auf „on hold“ gesetzt. Selbst das Scheitern ist einkalkuliert, die „Fallhöhe“ wäre vertretbar.
Es soll allerdings nicht der Eindruck entstehen, dass die Logik durch dieses Handlungsschema außer Kraft gesetzt wird, im Gegenteil. Das Handeln ist von (Nach-)Denken begleitet, man spricht nicht von Aktionismus. Das Einbeziehen von Zufällen als Chance bewirkt, dass der Prozess nicht immer in strenger Gleichmäßigkeit abläuft. Auch Sprünge sind möglich.
Auf längere Sicht geht es dem Unternehmer darum, mit den begrenzten Ressourcen auszukommen, dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit folgend aber auch irgendwann Gewinn zu erzielen. Sind die Ziele klar genug und stehen ausreichend Mittel zur Verfügung, ist es Zeit, vom Effectuation-Ansatz in den Modus der üblichen Geschäftsplanung zu wechseln.
Übertragung auf das Projektmanagement
Doch kann das, was erfolgreiche Unternehmer ausmacht, auch auf andere Bereiche des Geschäftslebens übertragen werden? Am Handlungsfeld des Projektmanagements wird untersucht, unter welchen Umständen und vor allem wie der Effectuation- Ansatz dort Eingang finden könnte.
Vorweg gesagt, es ist nicht beabsichtigt, Projektmanagement durch Effectuation zu ersetzen. Das ginge auch gar nicht, da die Voraussetzungen verschieden sind. In einem Projekt gibt es in der Regel von Beginn an ein klares Ziel, ein genehmigtes Budget, vorgesehenes Personal und Terminvorgaben. Projektmanagement beginnt im Grunde genommen da, wo Effectuation aufhört. Um den scheinbaren Widerspruch aufzulösen, blicken wir bei der Übertragung des Ansatzes auf den Überlappungsbereich zwischen beiden Herangehensweisen und auf solche Situationen, in denen klassische Ansätze im Projekt versagen. Es geht um die Erweiterung des methodischen Tool-Sets, des Werkzeugkastens für das Projektmanagement. Dabei wäre es schon ein Gewinn, wenn allein die Anwendung der Effectuation-Prinzipien im Sinne eines „Change of Mindset“ in bestimmten Situationen weiterhelfen würde. Realistischerweise ist Effectuation kein Allheilmittel, das jedes Problem beseitigen kann.
Vergleich mit agilen Methoden
Gehen wir einen Schritt zurück und sehen uns die Prinzipien von Effectuation noch einmal genauer im Vergleich mit den Prinzipien der agilen Softwareentwicklung an.
Aus den Kreativitätstechniken ist die Methode bekannt, für die Lösungsfindung das einzubeziehen, was das Problem verursacht. In der Softwareentwicklung tritt häufiger der Fall auf, dass spät eingereichte Kundenwünsche – vielleicht, weil die Anforderungen noch nicht klar waren – ein Projekt gefährden. Die klassische Herangehensweise löst diese Situation mit sogenannten „Change Requests“. In agilen Vorgehensweisen wird das „Reagieren auf Veränderung“ in den Stand eines Prinzips erhoben und von dort aus weitergedacht. Dort gibt es ebenfalls genau vier Prinzipien: das agile Manifest:
1. Individuen & Interaktionen über Prozesse & Tools
2. Funktionierende Software über umfassende Dokumentation
3. Zusammenarbeit mit Kunden über Vertragsverhandlungen
4. Reagieren auf Veränderung über Befolgen des Plans Beim Vergleich mit den Effectuation-Prinzipien zeigen sich einige Parallelen:

Man kann noch weitere Übereinstimmungen struktureller Art entdecken. Scrum zum Beispiel basiert auf kurzen Zyklen, den sogenannten Sprints. In den einzelnen Sprints werden die Anforderungen abgearbeitet und es entsteht inkrementell ein vollständiges System. Der Effectuation-Prozess basiert ebenfalls auf zyklischen Durchläufen, auch wenn diese Abfolge im Gegensatz zu Scrum nicht so streng befolgt werden muss. Mit jedem Zyklus werden Ziele konkretisiert und/oder weitere Mittel zur Verfügung gestellt, die für das Vorhaben eingesetzt werden können.
Trotz der vielen Ähnlichkeiten gibt es aber einen sehr wichtigen Unterschied, der oben bereits angesprochen wurde. Während inzwischen viele Softwareprojekte komplett auf agile Entwicklung setzen, möchten wir Effectuation nicht in seiner Gesamtheit, sondern lediglich punktuell und situationsbedingt im Projekt einsetzen.
Die Erfahrung zeigt, dass sich agile Methoden in IT-Projekten prinzipiell bewähren, wenn es das Umfeld zulässt. Aber wie es im Einzelfall in der Realität leider (öfter) der Fall ist, gibt es keine Erfolgsgarantie. So realistisch sollten wir auch bei Effectuation sein.
Die Konkretisierung
Es gibt viele Gründe, warum Projekte scheitern6, und es gibt viele Publikationen, die sich mit der Retrospektive von Projekten befassen und erklären, warum es schließlich so kommen musste. Wir versuchen, Lösungsvorschläge zu bieten, die helfen, einen Misserfolg im Vorfeld zu verhindern.
Mittelorientierung
Am Anfang ist der Plan, der im Projektteam abgearbeitet wird. Der Projektleiter greift bei Bedarf steuernd ein, nur kleine Korrekturen, eigentlich alles ganz einfach – in der Theorie.
Doch tatsächlich ist die Aufstellung des Projektplans die erste große Hürde in einem Projekt. Sind alle Rahmenbedingungen bekannt? Wie ist der Scope, das heißt, welche Arbeitspakete gibt es? Welche logischen Abhängigkeiten sind zu berücksichtigen? Wie lange dauert das Projekt wirklich? Wie soll das Ganze strukturiert werden?
Aus Sicht eines Unternehmers wäre die Situation eindeutig. Es geht los, auch wenn der Plan noch nicht da ist. Es gibt Workshops, erst zu allgemei nen Themen bezüglich des Projektvorgehens, dann spezifisch zu technischen und fachlichen Themen. Der Auftragnehmer ist aufgefordert, sich aktiv einzubringen, Vereinbarungen werden getroffen. Diese dürfen natürlich nicht im Widerspruch zu Inhalten des Vertrags zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer stehen, sondern sollen einen Sachverhalt konkretisieren. Die Ergebnisse aus den Workshops liefern die fehlenden Informationen (Mittel) für den Plan. Nach einem oder zwei Review-Zyklen existiert schon ein guter Plan.
Gestaltung und Kooperationspartner
Kommunikation ist wichtig, und doch scheitern Projekte oft genau an einem Mangel an Kommunikation der Projektbeteiligten. In einem Projekt braucht es viele Experten, die ganz spezifische Aufgaben erledigen müssen. Diese sprechen jedoch eine eigene, spezifische Sprache. Und manche Beteiligten können oder wollen nicht erklären, warum etwas wichtig ist oder was sie sich bei der Umsetzung einer Aufgabe gedacht haben.
Des Weiteren steigt die Anzahl der möglichen Kommunikationskanäle innerhalb eines Projektes exponentiell mit der Anzahl der Teilnehmer. Also alles keine wirklich guten Voraussetzungen für den Projektleiter, der ja eigentlich über alles informiert sein müsste, um gegebenenfalls steuernd einzugreifen.
Der Unternehmer würde das gelassen sehen, diese kreativen Austauschprozesse fördern und zum Mitmachen einladen. Erst später, mit der Umsetzung des Plans, wird es auf die Commitments der Mitgestalter ankommen – also auf ein ihren Aussagen entsprechendes Handeln („Walk the Talk“) – und er würde die Zusagen definitiv auch einfordern. Der Unternehmer kennt über sein Netzwerk viele andere Partner, auch jenseits der im Projekt identifizierten Stakeholder, und kann diese bei Bedarf zur Unterstützung mobilisieren. Und zur Not kann er eine Aufgabe auch mal selbst erledigen, er weiß ja, was er kann.
Verlust begrenzen und Chancen nutzen
Doch es gibt auch Ereignisse, extern oder intern, die auf keiner Risikoliste stehen und unter Projektleitern als „Krise“ gefürchtet werden. Manchmal ist es auch nicht ein Ereignis, sondern eine tragische Verkettung unglücklicher Umstände. Um Effectuation in einer solchen Situation anwenden zu können, ist die Sicht von einer abstrakteren Ebene aus erforderlich, eine Konkretisierung würde den Betrachter gedanklich zu sehr an einen Einzelfall binden.
Das Projekt hat einen Start- und einen Zielpunkt. Das „Navigationssystem“, das heißt der Projektplan, ist zielorientiert und sagt, wann die Ankunft sein sollte und wie viele Ressourcen unterwegs verbraucht werden. Doch wenn jetzt der direkte Weg zum Ziel plötzlich blockiert ist, nützt der Plan – und das Navigationssystem – nichts mehr. Im schlimmsten Fall führt jeder Versuch, das Ziel über andere, noch nicht erfasste Wege zu erreichen, zu: „Wenn möglich, bitte wenden“.
Der Unternehmer würde sich davon nicht beirren lassen und trotzdem fahren. Er ist krisenerprobt, für ihn geht es jetzt darum, den Verlust zu begrenzen, die Katastrophe zu verhindern. Er würde auf Besonderheiten der Situation achten und die bestehenden Mittel einsetzen. Durch sein Handeln verschafft er sich gleichzeitig Zeit zum Nachdenken. Möglich, dass er trotzdem scheitert. Aber als Alternativen blieben ohnehin nur Abbruch des Projekts oder eine komplette Umkehr. Letzteres heißt in der Projektsprache „Major Change & Re-Planning“. Das ist aber erst dann möglich, wenn sich die Lage wieder beruhigt hat. Denn erst, wenn sich die Situation stabilisiert, können wir einen neuen Plan machen.
Fazit
Der Artikel zeigt, was hinter Effectuation steckt, und beschreibt, wie Effectuation in gewissen Situationen in einem Projekt angewendet werden kann, auch wenn der Effectuation-Prozess als solches nicht notwendigerweise komplett durchlaufen werden muss. Entscheidend ist die Einstellung, sind die Prinzipien, von denen sich ein Projektmanager leiten lässt. In gewissen Situationen hilft es ihm, sich wie ein „Unternehmer“ zu verhalten.
Quellenangaben:
1 https://www.u-geist.at/effecutation-wissenschaftliche-basis/ (abgerufen am 25.08.2019)
2 https://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmertum (abgerufen am 12.08.2019)
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Entscheidung_unter_Ungewissheit (abgerufen am 12.08.2019)
4 Faschingbauer, M.: Effectuation – Wie erfolgreiche Unternehmer denken, entscheiden und handeln (3. Auflage). Stuttgart: 2017.
5 https://www.effectuation.org/?page_id=207 (abgerufen am 31.05.2019)
6 Dörner, D.: Die Logik des Misslingens. Strategisches Denken in komplexen Situationen. Reinbek bei Hamburg: 1992.