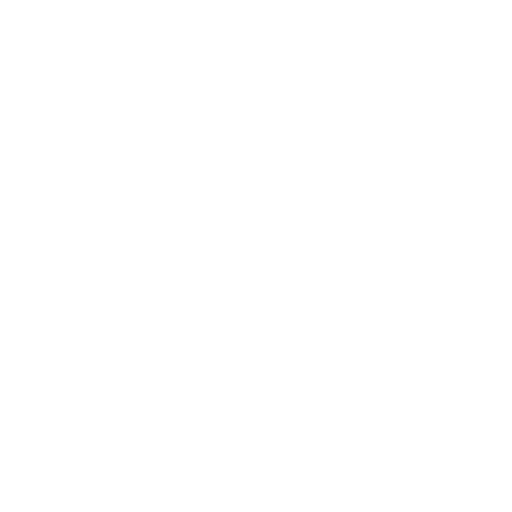KI kann die bestehenden, ohnehin digitalisierten oder digital unterstützten EDV-Prozesse ergänzen und erweitern. Verwaltungsprozesse sind häufig Entscheidungsprozesse. Diese umfassen, grob gesagt, häufig die fünf Schritte: Datenerhebung, Datenauswertung, Entscheidungsvorbereitung, Entscheidung und Nachbereitung der Entscheidung. Der Einsatz von KI ist in den meisten Bearbeitungsschritten von Verwaltungsprozessen möglich. Sie kann dabei helfen, Daten schneller und umfassender zu erheben, sie zu analysieren und auszuwerten, Daten aufzubereiten, Entscheidungen vorzubereiten und die Nachbereitung unterstützen oder automatisieren.
So lassen sich Chatbots (Chat, engl. plaudern, Bot, kurz für Roboter) im öffentlichen Sektor vielfältig einsetzen, insbesondere dort, wo es um Interaktion mit Kunden der öffentlichen Verwaltung geht: sei es für schnelle Antworten und Informationen zu Anliegen oder beim zielgerichteten Auffinden von Anträgen und Formularen. Die Funktionalitäten gehen dabei weit über die einer FAQ-Seite oder einer Google-Suche hinaus. Inhalte und Regeln erweitern sich generisch und adaptieren automatisch neue Inhalte, wodurch sie nicht bei Erweiterungen oder Änderungen veralten oder aufwendig angepasst werden müssen. Dies beschleunigt die Abwicklung von Bürgeranfragen und entlastet Beschäftigte der Verwaltung.
Ein Beispiel für einen erfolgreichen Chatbot im Öffentlichen Sektor ist der WienBot, der Chatbot der Stadt Wien. Der Zugriff auf den WienBot erfolgt über eine Homepage, eigene App mit Text- und Spracherkennung oder mittels Facebook Messenger. Der Chatbot kann eine Fülle von ganz unterschiedlichen Eingaben beantworten, unter anderem: Darf ich hier parken? Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich brauche einen neuen Reisepass. Was spielt die Oper? Wo ist der nächste Behindertenparkplatz? Wo kann ich mein Fahrrad abstellen? Er kann hierfür eingepflegte und trainierte Informationen, Erfahrungen und Feedback aus vorherigen Konversationen, wie auch Standortdaten und aktuelle öffentliche Verkehrsmitteldaten auswerten. Dabei sucht der Bot in einer Masse von Informationen die passenden Informationen auf Grundlage seines selbsterlernten Wissens über die Bedürfnisse seiner Nutzer heraus.
Ein weiteres Einsatzgebiet von KI ist die Dokumentenklassifizierung. Hierbei werden Dokumente beispielsweise bei der Formularerfassung, -erkennung, -auswertung und der -verarbeitung automatisch inhaltlich analysiert und kategorisiert. Dies kann im Posteingangs- oder Dokumentenmanagement angewendet werden, um eingehende Briefe, E-Mails oder Dateianhänge nach Typ, Inhalt, Adressat oder Fachbereich zu sortieren und direkt weiterzuleiten. Durch diese Klassifizierung können alle relevanten Informationen, unabhängig von ihrem Speicherort, zur Vorbereitung einer Entscheidung direkt gefunden und zusammengeführt werden.
Die Bundesagentur für Arbeit prüft den Einsatz überwachter Lernalgorithmen, um übermittelte Dokumente, wie Studiennachweise für Kindergeldanträge von Studierenden zu identifizieren, deren Inhalt zu analysieren und dem jeweiligen Antrag im System zuzuordnen. „Überwacht“ heißt, dass die Algorithmen keine festen, programmierten Regeln besitzen, sondern aus der Summe von menschlichen Entscheidungen (Zuordnungen) lernen, um beim nächsten Antrag selbstständig Vorschläge für eine Zuordnung zu machen. Diese wird vom Sachbearbeiter nur noch bestätigt.
KI hat das Potenzial, Prozesse zu revolutionieren, da sie enorme Datenmengen viel schneller verarbeiten und analysieren kann. Im Kern optimiert sie Abläufe, die bereits heute im Rahmen der Digitalisierung durch IT-Lösungen unterstützt werden. Behörden sollten daher zum einen aktiv weitere KI-Anwendungsfelder identifizieren und verfolgen und zum anderen bewusst entscheiden, wie sie den Einsatz gestaltet wollen.