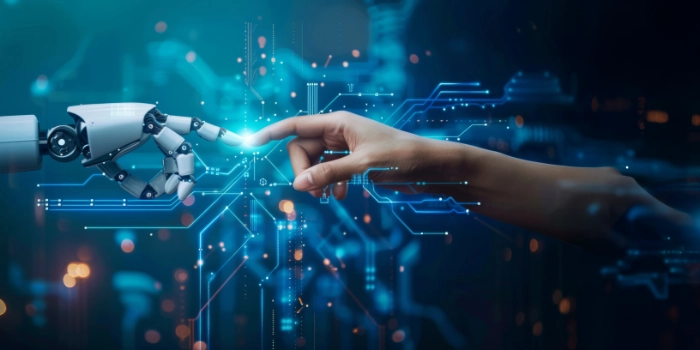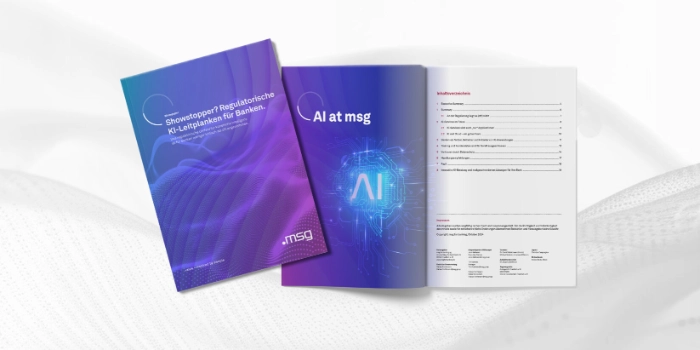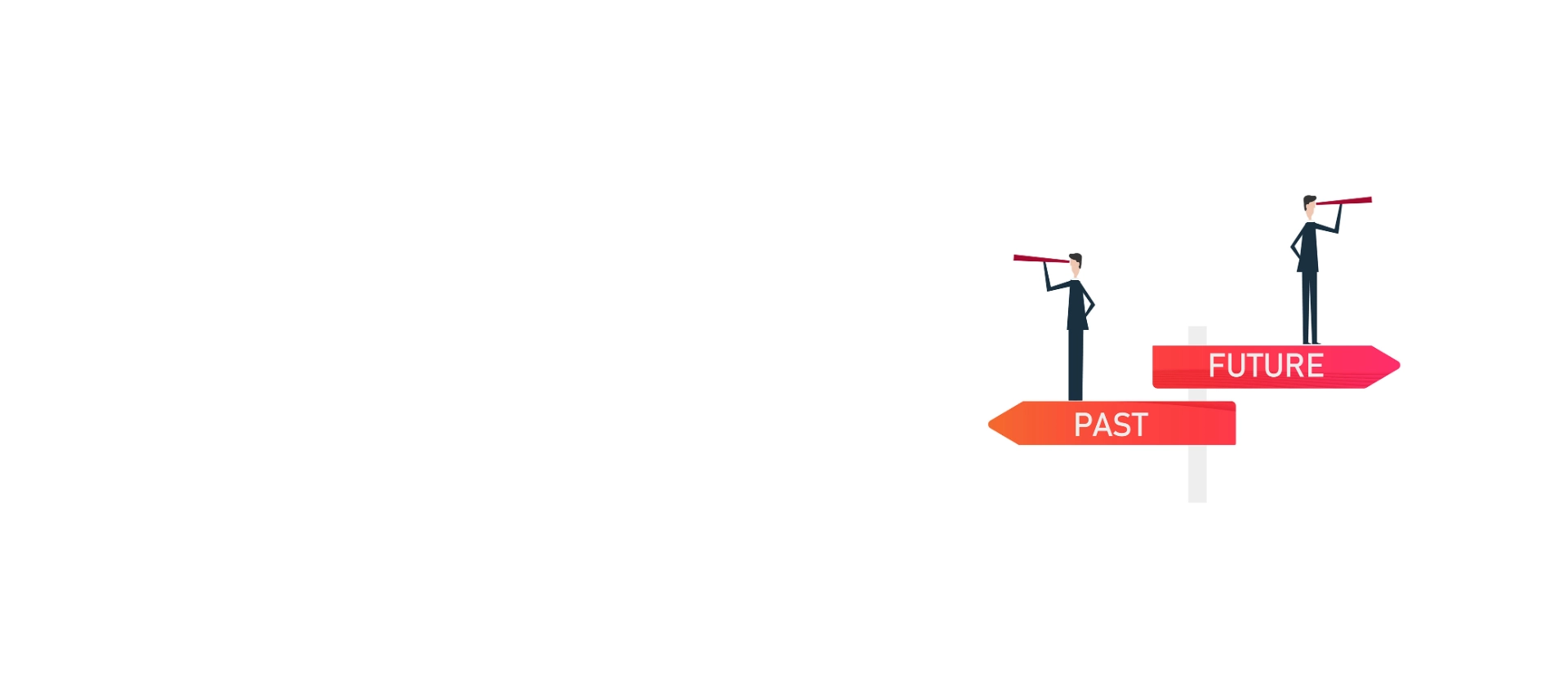
Öffentliche Verwaltung im Spiegel der Zeiten und Kulturen
Die Sozialreformen von Ernst I. von Sachsen-Gotha-Altenburg
von LEA DÖRFLINGER
Kennen Sie eigentlich Herzog Ernst I. von Sachsen-Gotha-Altenburg? Nein? Sein Name ist nur wenigen ein Begriff und das, obwohl er im 17. Jahrhundert mit seinem Regierungsstil die deutsche Verwaltung revolutionierte. Herzog Ernst I., wegen seines Einsatzes für den lutherischen Glauben auch Ernst der Fromme genannt, regierte ab 1640 das Herzogtum Sachsen-Gotha und begründete 1672 das Herzogtum Sachsen-Gotha-Anhalt. Fromm und revolutionär mögen auf den ersten Blick nicht zusammenpassen, doch Ernst I. bewies das Gegenteil: Während seiner Regierungszeit machte er es sich zur Hauptaufgabe, sein durch den Dreißigjährigen Krieg stark in Mitleidenschaft gezogenes Herrschaftsgebiet wieder aufzubauen, für Recht und Ordnung zu sorgen und sein Volk nach christlichen Werten zu erziehen – und zwar durch die Modernisierung seiner Landesverwaltung.
Um die Auswirkungen des Krieges zu mindern, eignete sich Ernst der Fromme bahnbrechendes Verwaltungsdenken an, das weitreichende Reformaktivitäten in fast allen sozialen und gesellschaftlichen Bereichen nach sich zog. Seine Sozialreformen umfassten die Erneuerung des Justiz-, Gesundheits- und Kirchenwesens ebenso wie die Einführung eines allgemeinen Bildungswesens. Maßnahmen, die uns heute selbstverständlich erscheinen, wie die Schulpflicht für alle Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren oder die Förderung der allgemeinen Grundbildung, waren damals revolutionär. Dabei beließ es aber Ernst I. nicht, denn er förderte auch die Eliten, unter anderem durch die Gründung des Gothaer Gymnasiums, das heute zu den ältesten Gymnasien Deutschlands zählt.
Außerdem schuf er drei neue Behörden, um die Regierungsverwaltung effizienter zu gestalten, gründete mehrere Druckereien und eine Münzstätte und widmete sich vielen weiteren Verwaltungsprojekten.
Insbesondere die nachhaltige Verbesserung der Bildungsbedingungen in Sachsen-Gotha-Altenburg zählt zu den großen Leistungen des Herzogs. Ihr Kernstück war der sogenannte Schulmethodus, der 1642 eingeführt wurde. Was verbirgt sich hinter diesem etwas sperrigen Begriff? Im Rahmen des Schulmethodus wurden erstmals allgemeine Richtlinien für den Unterricht aufgestellt, eine eigenständige Schulordnung für den Elementarunterricht eingeführt und einheitliche Lehrpläne verfasst. Da Herzog Ernst I. schnell erkannt hatte, dass eine solche Mammutaufgabe nicht allein zu bewältigen war, holte er sich Unterstützung durch den Pädagogen Andreas Reyher, der für die Konzeption des neuen Unterrichtswesens zuständig war.

Abbildung 1: Herzog Ernst I. von Sachsen-Gotha-Altenburg, posthumer Kupferstich, ca. 1677 (Quelle: Staatliche Kunstsammlungen Dresden)

Abbildung 2: Andreas Reyher im Kreise seiner Familie, um 1643 (Quelle: Schloss Friedenstein, Kulturgeschichtliche Abteilung)
Reyher war nicht der einzige kluge Kopf, den Ernst der Fromme zur Umsetzung seiner ambitionierten Reformvorhaben heranzog. So machte er zum Beispiel seinen Leibarzt Daniel Ludwig zum Reformer des Apothekenwesens. Die Zusammenarbeit mit Beratern und Fachleuten war entscheidend für den Erfolg der umfassenden Verwaltungsmodernisierung im Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg.
Die Modernisierung des Bildungs-, Gesundheits-, Justiz- und Verwaltungswesens beschäftigt Menschen und Politik bis heute. Herzog Ernst I. setzte im 17. Jahrhundert mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht und des Schulmethodus einen Meilenstein. Heute steht die Digitalisierung der Schulen im Mittelpunkt der Erneuerung des Bildungswesens, etwa durch eine bessere digitale Infrastruktur und die Förderung digitaler Kompetenzen in den Schulen. Heute wie damals ist das Gesundheitswesen ein Dauerthema im Bereich der Verwaltungsmodernisierung, heute stehen Fragen wie die elektronische Patientenakte im Mittelpunkt und nicht wie im 17. Jahrhundert das Verbot der Quacksalberei.
Auch wenn ihm sein christlich motivierter Ansatz und seine Glaubensverbundenheit zu Lebzeiten den Beinamen „Bet-Ernst“ einbrachten, wurde ihm während seiner Regierungszeit, vor allem aber nach seinem Ableben, viel Anerkennung für seinen Reformwillen und seine unermüdlichen Bemühungen um den Wiederaufbau des Herzogtums zuteil.
Und das zu Recht. Denn die Themen, denen sich Ernst der Fromme widmete, waren und sind für das Wohlergehen der Bevölkerung und für eine funktionierende Verwaltung von entscheidender Bedeutung.
Natürlich darf nicht unterschätzt werden, dass die damaligen und heutigen Verhältnisse keinesfalls eins zu eins zu vergleichen sind: Ernst I. stand nicht nur eine vierjährige Legislaturperiode zur Verfügung, er war schlichtweg 35 Jahre an der Macht. Fest steht, dass das stetige Streben nach Innovation und die Einführung zahlreicher Neuerungen den Herzog nicht nur zu einer bedeutenden Persönlichkeit der deutschen Geschichte, sondern auch zu einem Beispiel für die Bedeutung einer kontinuierlichen Modernisierung in der Verwaltung machten. „Wer rastet, der rostet“ scheint das Motto von Ernst I. gewesen zu sein, und so gilt es auch heute: Neues zu wagen, Innovationen umzusetzen und zukunftsweisende Wege zu beschreiten, ist entscheidend für nachhaltigen Erfolg.
Quellen
Beck, August (1877): Ernst I., in: Allgemeine Deutsche Biographie, 6, 302–308
Damals+ (2013, 02. Mai): Bildungsgeschichte in Gotha, Damals.de
Heß, Ulrich (1959): Ernst I., in: Neue Deutsche Biographie, 4, 622–623
Steiger, Johann Anselm, & May, Franziska (2013): Herzog Ernst der Fromme und die sog. Kurfürstenbibel (1641). Höfische Repräsentation und Kommunikation des Wortes Gottes, in: Daphnis, 42(2), 331–378.
Universität Erfurt (2014): Herzog Ernst I. – der Pazifist, der Erneuerer, der Fromme, WortMelder